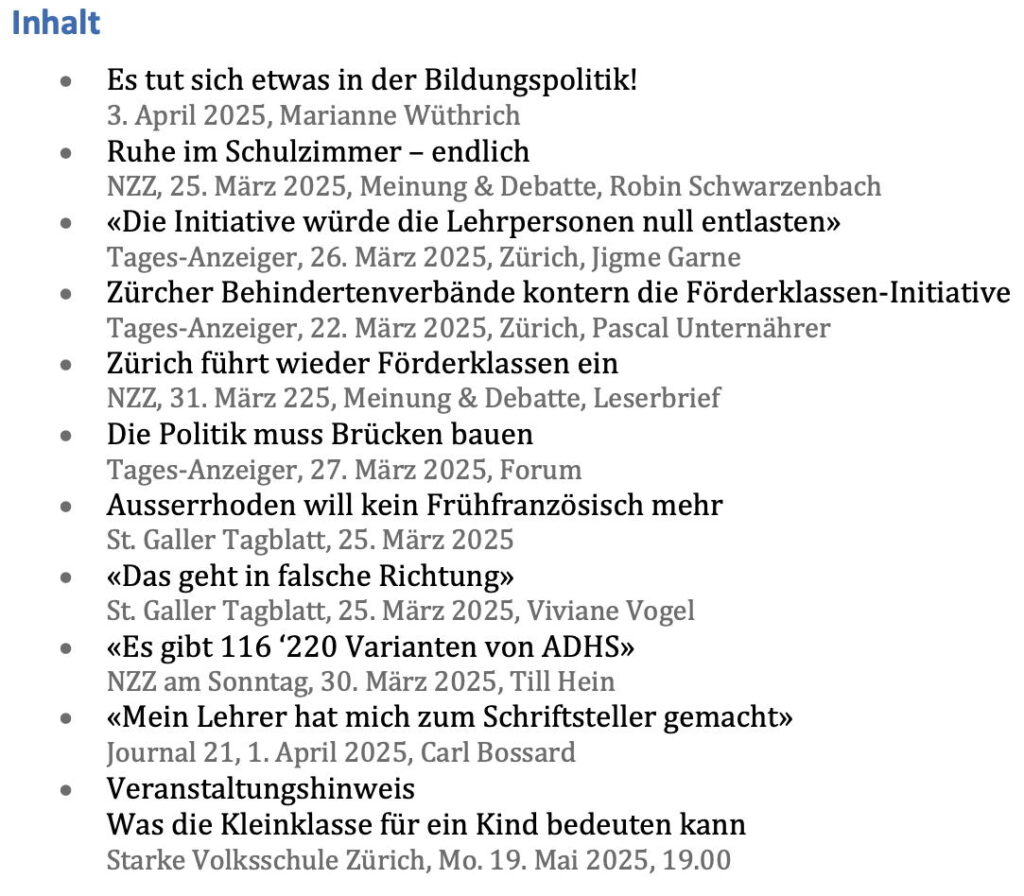Es tut sich etwas in der Bildungspolitik!
Ein absoluter Hit
Absoluter Hit der letzten zwei Wochen ist der mutige Entscheid des Zürcher Kantonsrats für die Förderklasseninitiative. So etwas ist in unserem Land eher ungewöhnlich: Ein Parlament stimmt dem Wortlaut einer Volksinitiative 1:1 zu. Offensichtlich ist es auch im Zürcher Rathaus angekommen, dass die integrative Schule gescheitert ist.
Weil die Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung eingereicht wurde, muss der Regierungsrat ihren Inhalt nun mit einer Gesetzesänderung umsetzen. Dabei sollten wir der Zürcher Bildungsdirektorin genau auf die Finger schauen, damit sie den Auftrag des Parlaments «nicht verwässert», so Robin Schwarzenbach in der NZZ. Sein Kommentar setzt die richtigen Akzente, mit Ausnahme des Titels (Ruhe im Schulzimmer – endlich). Um eine ruhigere Lernatmosphäre in der Regelklasse geht es zweifellos auch, aber nicht nur. Ebenso wichtig sind adäquate Lernbedingungen für Kinder, die in einer Kleinklasse besser gefördert werden können.
Sinnvolle und weniger sinnvolle Reaktionen
Die Gegenreaktionen auf den Kantonsratsentscheid liessen nicht lange auf sich warten. Von der Präsidentin des ZLV kamen die ewig gleichen, längst widerlegten «Argumente», deren Wiedergabe wir uns hier sparen. Einzig ihre Antworten zur Basler Umfrage, wonach 85% der befragten Lehrerinnen die flächendeckende Einführung von Kleinklassen befürworten, lassen wir uns auf der Zunge zergehen. Basel habe «eine ganz andere Ausgangslage als Zürich», so Lena Fleisch, weil dort erweiterte Lernräume nicht möglich seien. Soll heissen: Wer «erweiterte Lernräume» hat (was immer das genau bedeuten soll), benötigt keine Kleinklassen? Der Clou des Interviews ist der Versuch der Dame, sich um eine Befragung der Zürcher Lehrerschaft zu drücken: «Weil die Integration an den Zürcher Schulen so unterschiedlich gelebt und umgesetzt werde», sei «eine repräsentative Umfrage kaum möglich, wäre entweder sehr aufwendig oder würde keinen Sinn ergeben.» Da stellt sich die Frage: Wozu braucht es einen Lehrerverband, wenn dessen Spitze mit derart absurden Ausreden daherkommt, statt sich für die Anliegen der Mitglieder zu interessieren?
Vonseiten der Zürcher Behindertenverbände folgte auf den Kantonsratsentscheid postwendend die Ankündigung einer eigenen Volksinitiative mit dem zahnlosen Titel «Initiative Schule für alle» und der fragwürdigen Begründung, die Förderklasseninitiative stehe im Widerspruch zur UNO-Behindertenkonvention. In unserem Newsletter wurde diese Interpretation der Konvention schon mehrmals richtiggestellt.
Drei aktuelle Leserbriefe putzen unsere Köpfe durch. Deren Autoren klären «die Begriffsverwirrung rund um Förderklassen und Integration», erläutern, was das Recht des Kindes auf Bildung laut der UNO-Kinderrechtskonvention beinhaltet oder konstatieren, dass die Rückkehr zu einer Schule, in der die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, ein durchaus erwünschter «Rückschritt» wäre.
Richtig Französisch lernen in der Sek
Die zweite erfreuliche Nachricht stammt aus dem Appenzellerland. Der Ausserrhoder Kantonsrat schaffte am selben Tag, an dem seine Zürcher Kollegen die Förderklassen einführten, das Fach Französisch in der Primarschule ab. In anderen Kantonen wird ebenfalls darüber diskutiert. Dass in der Romandie nicht alle zufrieden sind mit diesem Beschluss aus Herisau, müssen wir Deutschschweizer akzeptieren. Allerdings ist die Behauptung, damit werde das Französisch-Niveau noch weiter sinken, schlicht falsch. Es gibt genügend Untersuchungen, die das Gegenteil belegen. Wenn Jugendliche in der Oberstufe den Aufbau einer Fremdsprache von Grund auf durch ihre Lehrerin vermittelt bekommen, sitzt die Sprache schneller und besser als mit den Sprachhäppchen, die sie in der Primarschule sogenannt spielerisch aufschnappen. Und es macht erst noch mehr Freude, wenn man wirklich zu verstehen beginnt, wie ein französischer Satz klingt und was drinsteht.
Fragezeichen hinter ADHS-Diagnosen
Hochinteressant und erhellend ist das ausführliche und in die Tiefe gehende Gespräch mit dem Psychologen Stephan Schleim über ADHS in der NZZ am Sonntag. Allein schon die einleitenden Fragen verlocken zum Weiterlesen: Ist ADHS ein echtes Volksleiden oder eher die Pathologisierung von einem Verhalten, das früher als normal galt? Welche Rolle spielt die Pharmaindustrie dabei? Stephan Schleim lässt sich durch die Fragen des Interviewers nicht von seiner durch reiche Erfahrung erworbenen Gewissheit ablenken, dass die weit verbreitete Diagnose ADHS eine ausgesprochen unklare Sache ist. Insbesondere weist er darauf hin, dass eine Gehirnstörung als Ursache der Symptome, die üblicherweise damit verbunden werden, nicht erwiesen ist.
Keinen Moment vergisst der Interviewte, dass seine Aufgabe als Psychologe nicht in erster Linie ist, Etiketten aufzudrücken und Medikamente zu verabreichen, sondern den Ursachen gestörten Verhaltens im Gemütsleben eines Kindes nachzugehen. Er nimmt klar Stellung und gibt sehr anschauliche Antworten. «Wenn Sie einen Sohn mit starken Schulproblemen und einer ADHS-Diagnose hätten, würden Sie ihm von Medikamenten abraten?» wird er im Interview gefragt. Schleim entgegnet: «Zunächst würde ich mich fragen, welche Schulform für den Jungen geeignet ist. Dann käme die psychologische Ebene: Hat er vielleicht noch nicht gelernt, einmal still zu sitzen oder seine Zeit einzuteilen? Wie kann ich ihn da unterstützen? Lobe ich ihn genug, wenn er einmal sozusagen ‹gut funktioniert›? Wenn das alles nichts bewirkt, würde ich sagen: Vielleicht probieren wir auch einmal Medikamente aus.» Eine solche klärende Stellungnahme tut in der heutigen Zeit des Diagnose-Booms not.
Hommage an Peter Bichsel und seine Kunst des Erzählens
Carl Bossard macht einmal mehr vor, wie man Leser und Zuhörer in Bann zieht. Seine eigene Faszination an der Kunst des Erzählens macht ihn zur geeigneten Persönlichkeit, um den kürzlich verstorbenen Peter Bichsel zu würdigen. Was für ein berührender Bericht von seinem Erlebnis einer Lesung mit dem Dichter! Feinfühlig greift Bossard die pädagogische Lehre aus dessen Werk auf: «Bedeutsam bleibt das Erzählen», das sich nicht auf Arbeitsblätter reduzieren und – ist zu ergänzen – auch nicht in digitale Programme verpacken lässt.
Besonders spannend ist für mich als Deutschlehrerin der Gedanke Bichsels, dass man auch «die Grammatik erzählen» kann. Erinnern Sie sich an das Gedicht «Der Werwolf» von Christian Morgenstern? Da geht es, wie immer bei Morgenstern mit Humor, um die grammatikalischen Fälle (der Werwolf, des Weswolfs, dem Wemwolf…) und darum, dass es von «wer» keine Mehrzahl gibt, was dem nicht gelehrten, aber lebenspraktischen Werwolf nicht einleuchten will, weil er ja eine Familie hat.
Sehen Sie, diese Assoziation, diese Gedankenverknüpfung zwischen dem Erzählen von Grammatik und dem Gedicht von Morgenstern konnten meine Hirnzellen Jahrzehnte später hervorrufen – keine KI wäre dazu fähig.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit der dieses Mal wirklich weitgehend erfreulichen Lektüre.
Marianne Wüthrich