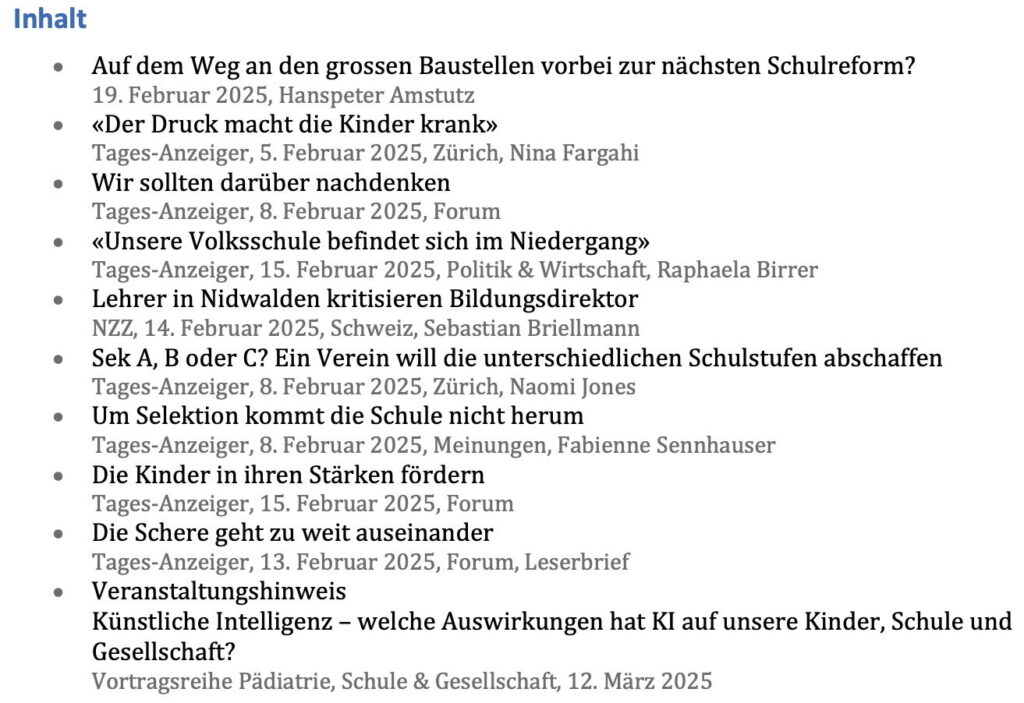Auf dem Weg an den grossen Baustellen vorbei zur nächsten Schulreform?
Die umtriebigen Schulreformer können es nicht lassen. Statt sich entschlossen den langjährigen Baustellen unserer Volksschule zuzuwenden, unterstützt der Vorstand der Schweizer Schulleitervereinigung fragwürdige Umbaupläne des Vereins «Schule ohne Selektion». Die Sekundarschule soll auf Abteilungen mit differenzierten Anforderungen verzichten. Mit in diesem Paket ist auch die Forderung nach einem neuen Beurteilungssystem, welches die bisherige Notengebung ersetzen soll. Wie immer bei solchen Vorhaben lassen sich weitere Akteure leichter an Bord holen, wenn grosse Schlagworte wie Chancengleichheit oder Individualisierung des Unterrichts ein Projekt heller leuchten lassen. So hat die LCH-Präsidentin durchblicken lassen, dass sie eine Oberstufe ohne Selektion als Fortschritt sehe. Auch an einigen Pädagogischen Hochschulen kann das Umbauprojekt auf eine namhafte Anhängerschaft zählen.
Zu viel Heterogenität würde die Sekundarschule schwächen
Die Ankündigungen, nur radikale Strukturreformen und ein neues System der Schülerbeurteilung würden die Schulen zukunftstauglich machen, sind ziemlich vollmundig. Neuere Studien zeigen, dass die Schulleistungen in einer nicht gegliederten Sekundarschule eher schlechter werden. Am Ende der sechsten Klasse geht die Schere beim Leistungsvermögen der Schüler bereits stark auseinander. Diese Heterogenität macht es Lehrpersonen ausserordentlich schwer, alle Schüler zu den gesteckten Zielen zu führen. In Oberstufenschulen mit Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen gelingt es weit besser, jeder Schülerin und jedem Schüler Erfolgserlebnisse beim Lernen zu ermöglichen.
Im Kanton Zürich stehen den Sekundarschulen ein zweiteiliges und ein dreiteiliges Modell mit flexiblen Varianten bei den abteilungsübergreifenden Fächern zur Auswahl. Es gab schon mehrmals intensive Diskussionen um die Licht-und Schattenseiten der beiden Systeme, doch die Einführung einer selektionsfreien Sekundarschule war dabei nie ein ernsthaftes Thema. Statt so eine Rosskur in Angriff zu nehmen, wäre es weit besser, den Hebel dort anzusetzen, wo Reformen die grösste Wirkung auf die Schulqualität haben.
Die Diskussion um eine radikale Sekundarschulreform ist eine Flucht nach vorn
Was die Schulleitervereinigung in Kooperation mit den genannten Unterstützern fordert, lenkt von den dringend zu lösenden Aufgaben ab. Die schulischen Herausforderungen sind bestens bekannt: Der chronische Lehrermangel, die gescheiterte Integration, das ineffiziente Frühfremdsprachenkonzept, der überladene Lehrplan mit den eklatanten Schwächen im Bereich Deutsch und die zu wenig auf die Schulpraxis ausgerichtete Lehrerbildung. Aufgrund dieser unerledigten Arbeitsliste macht die angezettelte Reformdiskussion den Eindruck einer schlecht vorbereiteten Flucht nach vorn.
Liebe Schulleitervereinigung, wo sind eure konstruktiven Vorschläge, die sich in der Praxis auch umsetzen lassen? Mehr finanzielle Mittel, wie ihr sie beim Integrationsmodell gebetsmühlenartig fordert, sind nirgends in Sicht. Mit eurem dogmatischen Verharren auf der reinen Lehre der Integration aller Schüler in die Regelklassen blockiert ihr praxistaugliche Lösungen. Beim gravierenden Lehrermangel genügt es nicht, Lehrer als Manager zu bezeichnen, um die fehlenden Männer für die Primarschule zurückzugewinnen. Es braucht starke Korrekturen beim Rollenbild des Lehrers, um diesem Beruf seine volle Attraktivität zurückzugeben. Das ist eine gewaltige, aber lohnenswerte Aufgabe, welche ein Denken ohne Scheuklappen erfordert.
Bei den Frühfremdsprachen wäre es zusammen mit dem LCH eure Aufgabe, der EDK mit deutlichen Worten klarzumachen, dass man sich mit dem gewagten Mehrsprachenkonzept verrannt hat. Ein grundsätzlich schiefes Konzept lässt sich nicht retten, indem man die vielen überforderten Kinder einfach dispensiert oder einen erhöhten Lerndruck zulässt. Jedes Weitermachen wir bisher führt zu unzähligen Verlierern, die ohne das forcierte Fremdsprachenlernen nicht entstehen würden.
Namhafte Persönlichkeiten fordern eine Korrektur der Fehlentwicklungen
In unserem Newsletter kommen namhafte Persönlichkeiten zu Wort, die in Interviews und Kommentaren die Schulentwicklung offen kritisieren. Die ganze Reihe der Schulbaustellen kommt dabei eingehend zur Sprache. Die Mutlosigkeit der Reformer, gescheiterte Projekte rechtzeitig abzubrechen, wird als Hindernis für eine Wende zum Besseren gesehen. Auslöser dieser Welle bemerkenswerter Stellungnahmen war wohl das viel beachtete Interview des Nidwaldner Bildungsdirektors Res Schmid vor knapp einem Monat. Wir haben darüber im letzten Newsletter berichtet.
Der neue Leiter der Kinderspitals Zürich, Oskar Jenni, setzt sich mit dem Frühfranzösisch auseinander. Er kritisiert die Idee des spielerischen Sprachbads (Embedding) als nicht umsetzbare Methode für das schulische Fremdsprachenlernen. Die ganze Mehrsprachendidaktik der Primarschule sei gescheitert und das Frühfranzösisch abzuschaffen.
SVP-Nationalrat Benjamin Fischer unterstützt in seinem ganzseitigen Interview in den TA-Medien die Kritik von Res Schmid vollumfänglich. Fischer hebt hervor, dass viel zu viele Schüler nur noch ungenügend Deutsch sprechen und kaum einfache Texte verstehen können. Er ist für die Einführung von speziellen Klassen zur Deutschförderung bei eingewanderten Kindern. Auch er möchte, dass nur eine Fremdsprache in der Primarschule unterrichtet wird.
Breite Unterstützung aus der Leserschaft für die mutige Reformkritik
In den Kommentaren und Leserbriefen findet man grosse Zustimmung zu den Interviews. Nur Neuerungen, die sich bewährt haben, sollen weitergeführt werden. Aber auch eine konträre Stimme von der Spitze des Nidwaldner Lehrerverbands, welche die meisten Reformen verteidigt und den eingeschlagenen Weg weitergehen will, ist dabei. Wie auch immer, die geäusserte Kritik an den zentralen Reformen ist so gut begründet, dass sich die Bildungspolitik die Taktik des Schönredens nicht länger leisten kann.
Hanspeter Amstutz