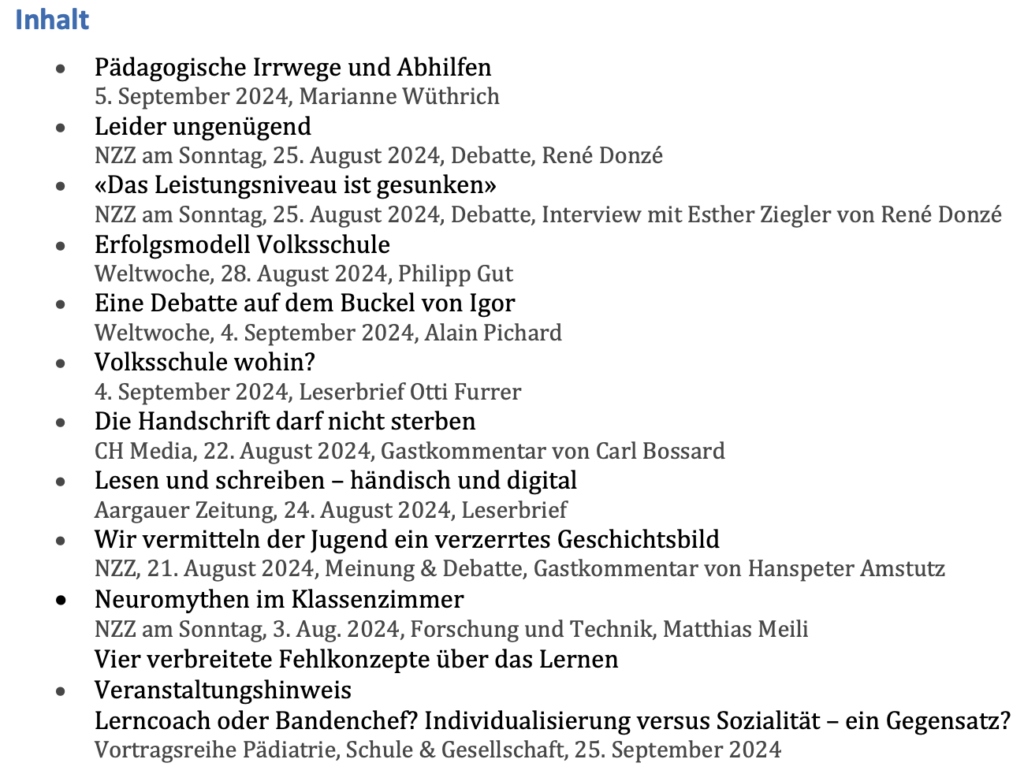Pädagogische Irrwege und Abhilfen
Es stellt einen so richtig auf, dass wir in unserer aktuellen Textsammlung gleich drei Artikel anbieten können, die umfassende und grundsätzliche Kritik am Zustand der heutigen Volksschule üben. Offenbar hat es sich – auch dank des steten Einsatzes von uns langjährigen Reformkritikern – herumgesprochen, dass in unserer Volksschule einiges im Argen liegt. Neben vielen anderen Kritikpunkten schreibt Philipp Gut («Erfolgsmodell Volksschule»), es brauche «Lehrer und Lehrerinnen, die da sind, die ihre Klasse kennen, sie führen, im Griff haben». Damit fordert er unmissverständlich die Abkehr von der Theorie des Selbstorganisierten Lernens SOL, die schon manchem Kind schulisch das Genick gebrochen hat, und die Wiederaufnahme eines geführten Klassenunterrichts. René Donzé kontert in seinem Artikel («Leider ungenügend») unter anderem die abstruse Behauptung von Deutschdidaktikerin(!) Johanna Bleiker, die Kinder bekämen keine Freude am Schreiben, wenn der Lehrer ihre Fehler korrigiert: «Wenn ein Kind hundertmal ‹Muter› mit einem t schreibt, dann bringen Sie das später kaum mehr weg». Das sollte eigentlich auch einer Deutschdidaktikerin einleuchten, ausser sie ist der Ideologie des Lehrplan 21 auf den Leim gekrochen.
Dass heute manche Lehrkräfte in allen Stufen der Volksschule kaum Fehler korrigieren und schon gar keine Diktate mehr schreiben lassen, trägt nichts zur Schreibfreude bei, sondern damit lassen sie die Kinder im Stich. Dabei geht es nicht nur um die Rechtschreibung, sondern auch um Grammatik, Satzbau und Wortwahl. Einer der wichtigsten Einwände gegen das Kompetenzmodell des Lehrplan 21 ist, dass zum Beispiel die deutsche Sprache nicht mehr strukturiert unterrichtet, sondern nur punktuell aufgegriffen werden soll. Wie sollen die Kinder so Deutsch lernen?
Kinder brauchen Anleitung und Korrektur
Ein absolutes Highlight (mangels eines treffenderen Ausdrucks ausnahmsweise in Neudeutsch!) ist das Interview mit der Primarlehrerin, Lehr- und Lernforscherin Esther Ziegler in der NZZ am Sonntag («Das Leistungsniveau ist gesunken»). Fachkundig, überzeugend und erfrischend erklärt sie neben vielen weiteren pädagogisch wichtigen Aspekten zum Beispiel, wie Eltern und Lehrer dazu beitragen können, dass die Kinder Freude am Lesen und Schreiben bekommen. Besonderen Wert legt Esther Ziegler darauf, dass Kinder angeleitet und korrigiert werden müssen und dass viel Üben notwendig ist, damit der Lernstoff sitzt.
Aus meiner eigenen Berufserfahrung kann ich ergänzen, dass die geübte Lehrerin selbstverständlich bei jedem Schüler abschätzt, wie viele Fehler sie in einem Deutschtest anstreichen soll. Es macht Sinn, bei einem schwächeren Schreiber von Mal zu Mal nur die Gross- und Kleinschreibung oder die Fallfehler zu korrigieren und darauf zu achten, dass er dabei etwas lernt. Meine Berufsschüler liebten es, wenn ich an den Rand einer Zeile 1 oder 2 Striche machte. Das hiess, in dieser Zeile stecken ein oder zwei Fehler. Die meisten wollten diese mit grossem Eifer herausfinden. Wenn sie nicht sicher waren, fragten sie ihren Nachbarn und prägten sich die richtige Schreibweise so eher ein (ich hörte mit einem Ohr mit). Bei den guten Schülerinnen strich ich oft alle Fehler auf diese Weise an, bei den anderen das, was pädagogisch sinnvoll war. Warum soll das Lernen so keinen Spass machen?
Ohne Üben kein Lernerfolg
Das Abtun des Übens als «Kasernenhof-Drill» wird von Esther Ziegler, René Donzé und Philipp Gut übereinstimmend in Frage gestellt. Ohne unermüdliches Üben lernt man weder Geige spielen noch einen Fussball ins Tor schiessen, und ebenso wenig rechnen und schreiben. Klar braucht es einigen Durchhaltewillen, und klar muss man beim Lernen auch einmal die Zähne zusammenbeissen, wenn ein Text oder eine Mathe-Aufgabe einfach nicht stimmen will. Aber das sind die Anforderungen des menschlichen Lebens, mit Unebenheiten und Widrigkeiten fertigzuwerden, das macht junge und ältere Menschen stark und selbstbewusst.
Dass man üben muss, um im Lernen voranzukommen, gilt übrigens auch für leistungsstarke Schüler, wie Esther Ziegler festhält, denn die Hälfte (!) der Kinder in ihrem Gymi-Vorbereitungskurs «kann nicht einmal das Einmaleins richtig gut». Sie erklärt auch warum: «Es wird zu wenig geübt, vieles bleibt an der Oberfläche. Dazu kommt, dass sich die Schule mit der Integration aller zu sehr an den Schwachen orientiert. Die ganz Starken brauchen weniger Wiederholung, da ist es weniger problematisch – aber das breite Mittelfeld geht so vergessen.» Wenn man das so schwarz auf weiss zu lesen bekommt, kann man nur einmal mehr darauf bestehen, dass dringendes Handeln angesagt ist!
Im Zusammenhang mit diesen und anderen Problemfeldern wird auch die integrative Schule von allen drei Autoren als untauglich erkannt. Diesem Thema haben wir uns schon mehrmals gewidmet. Lesen Sie dazu den Artikel von Alain Pichard («Eine Debatte auf dem Buckel von Igor») und den Leserbrief des langjährigen Sonderklassenlehrers Otti Furrer («Volksschule wohin?»).
Frühfremdsprachen abschaffen!
Ein Schmunzeln können wir alten Kämpfer gegen die Frühfremdsprachen uns nicht verkneifen, wenn heute in der Weltwoche oder der NZZ am Sonntag zu vernehmen ist, diese seien «dringend wieder abzuschaffen», damit mehr Zeit für Deutsch, Mathematik und handwerkliche Fächer bleibt. Lieber spät als nie!
Geist an den PH ist das Problem
Da ich der zentralen Frage der Lehrerbildung mein letztes Vorwort gewidmet habe, greife ich hier nur zwei Bemerkungen aus unserer Sammlung auf. Esther Ziegler: «Den Lehrpersonen darf man keinen Vorwurf machen. Das Problem ist der Geist, der an den pädagogischen Hochschulen vorherrscht: Man soll nicht mehr frontal unterrichten, soll weniger vorzeigen und erklären (…)» (lesen Sie im Interview weiter). Philipp Gut: Die Lehrerseminare «wurden aufgelöst zugunsten von pädagogischen Hochschulen, die allerdings kein allzu hohes wissenschaftliches Niveau aufweisen. Ihr grösseres Manko ist, dass sie keinen genügenden Praxisbezug aufweisen und die Junglehrkräfte so nicht richtig auf ihre Aufgabe vorbereiten (…).»
Hier ist besonders dringendes Handeln nötig!
Zwei pädagogische Plädoyers
Das Plädoyer von Carl Bossard («Die Handschrift darf nicht sterben») für ein dem Menschen entsprechendes Benutzen unserer Hände nicht nur zum Klicken und Tippen, sondern auch zum Schreiben von Hand und zu all den praktischen Handgriffen, die das Leben von uns fordert, darf in unserer Sammlung nicht fehlen: «Kinder, die im Sandkasten Burgen bauen, die Bäche stauen und mit Bauklötzen Türme konstruieren, brauchen ihre Hände. Sie greifen zu und begreifen gerade darum zusehends die Welt.» Mit seinen eindringlichen Ausführungen macht uns Carl Bossard darauf aufmerksam, dass der Mensch mit seinen geistigen und praktischen Fähigkeiten weit über jeder elektronischen Maschine stehen muss, die ihm nur als Hilfsmittel dienen kann.
Gerade für die Weiterexistenz des dualen Berufsbildungssystems, das Philipp Gut in seinem Artikel mit Recht als einen der Gründe für den guten Stand des Schweizer Wirtschaftsplatzes würdigt, ist die praktische Übung der Hände vom Kindergarten bis zur Oberstufe unabdingbar. Es stimmt, dass die jungen Schweizer Berufsleute an den World Skills seit Jahren mehr Medaillen gewinnen als die meisten anderen. Aber ohne die Skills, also das Wissen und die praktischen Fertigkeiten, von klein auf und später in der Berufslehre intensiv zu trainieren, wäre dies nicht möglich. Der Computer allein bringt's nicht!
Das zweite Plädoyer ist die Kritik meines Redaktionskollegen Hanspeter Amstutz am politisch oft äusserst einseitigen Geschichtsunterricht und sein Aufruf, «dass wieder relevante Bildungsinhalte den Geschichtsunterricht prägen» müssen («Wir vermitteln der Jugend ein verzerrtes Geschichtsbild»).
Hirnforschung: Unterricht als hochkomplexer Prozess
Als interessanten Abschluss unseres Newsletters präsentieren wir Ihnen sozusagen einen Weiterbildungskurs für Pädagogen aus der Welt der Hirnforschung. In meiner Zeit als Berufsschullehrerin hatten meine Klassen ein Lehrmittel «Lern- und Arbeitstechnik», das manche Jugendlichen darin bestärkte, sie seien halt visuelle Typen und könnten deshalb nicht gut geschriebene Begriffe oder Texte lernen. Oder sie hätten Probleme, sich gedanklich mit einer Frage auseinanderzusetzen, weil ihre kreative Hirnhälfte besser entwickelt sei als die kognitive. Mir leuchteten diese Theorien schon damals nicht ein, machte ich doch die Erfahrung, dass meine Heranführung der Schüler an den Schulstoff und unsere inhaltlichen Diskussionen darüber im Klassenunterricht eine viel bedeutendere Rolle spielten als die «Hirntypen». Aber auch die persönliche Ermutigung der einzelnen Schülerin oder in manchen Fällen das Setzen eines Stachels, der den Ehrgeiz oder die Neugier eines scheinbar desinteressierten Jugendlichen weckte, liessen die Frage der Hirnhälften verblassen.
Den Beweis für meine Vermutung lieferten meine Schüler selbst: In meinem ganzen Arbeitsleben kam es fast nie vor, dass einer von ihnen die Theorieprüfung definitiv nicht bestanden hat, wenn er den Führerschein für den Töff oder das Auto haben wollte. Immer wieder staunte ich, wie Jugendliche, die angeblich nicht fähig waren, sich für eine Schulprüfung ein paar Sätze oder Begriffe einzuprägen, weil sie ein «visueller» oder »kreativer» Typ waren, viel mehr Lernstoff bewältigten, wenn sie ein Auto lenken wollten.
Mit dieser erheiternden, aber nachdenklich stimmenden Anregung wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre.
Marianne Wüthrich